


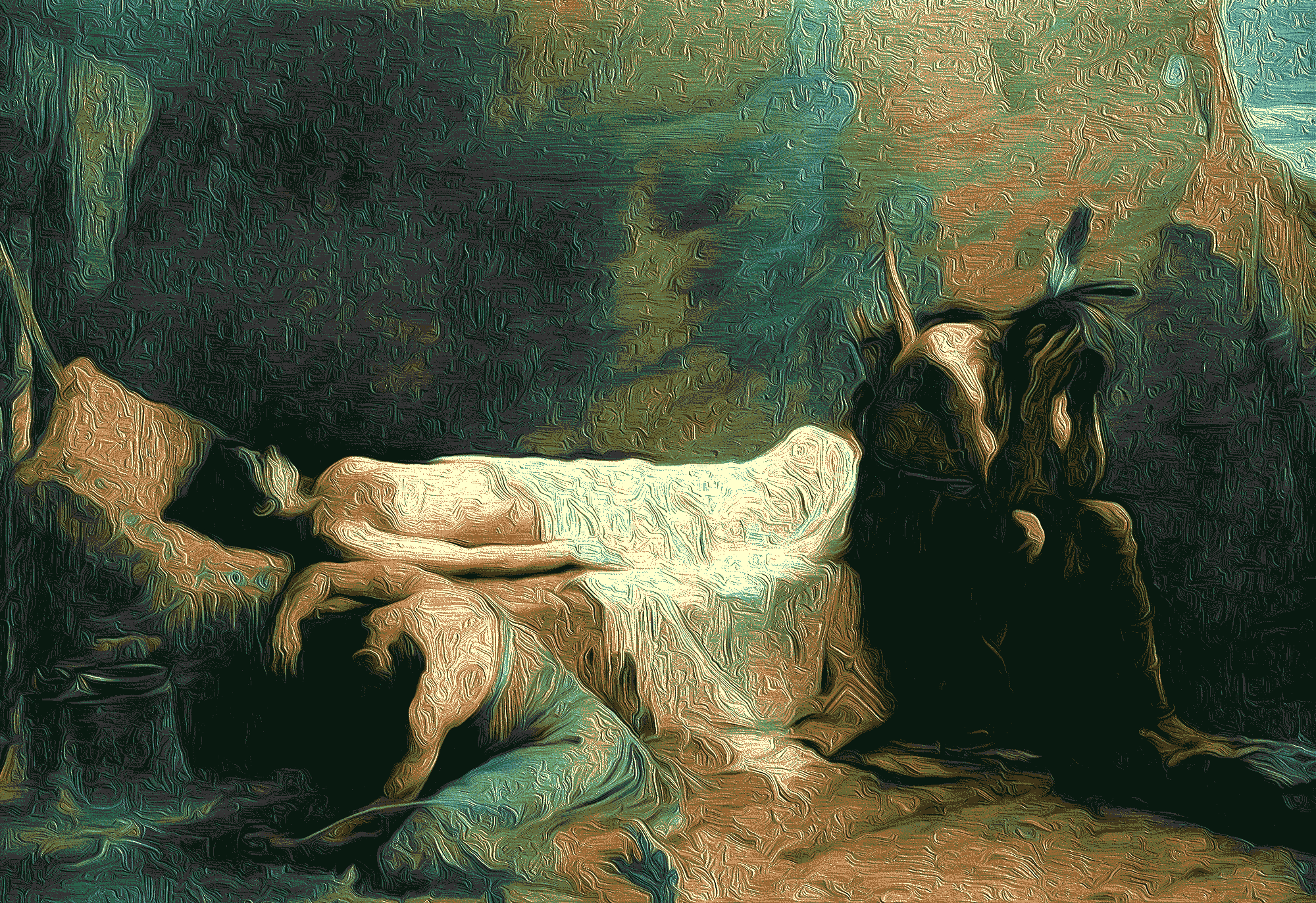
Text Patrick Hahn
Titelbild William de Leftwich Dodge (Public Domain)
Als der Blechbläserchoral das Largo aus Antonín Dvořáks Neunter Sinfonie eröffnet, bleibt der Blick der Programmheftleserin im Konzert an einem Bild haften: langes, pechschwarzes Haar wird von einem prächtigen Kranz von Adlerfedern gekrönt, sie bilden einen Rahmen für das glatte, bartlose, scharf geschnittene Gesicht aus dem heraus zwei dunkle Augen die Programmheftleserin unverwandt anblicken, der muskulöse Oberkörper ist nackt. Die Leserin überlegt, ob sie jemals zuvor in ihrem Programmheft einen Mann mit nacktem Oberkörper gesehen hat, sieht man von Haydn, Beethoven, Mozart doch ohnehin meist eines jener drei Gemälde, die es von ihnen gibt und von Brahms stets die Fotos im Sonntagsstaat. Auf dem Streicherteppich setzt nun das Englischhorn mit einem melancholischen Solo ein. Das Thema ist schön. Es berührt die Hörerin. Und während sich die Härchen an ihrem Unterarm für einen kurzen Augenblick aufrichten, liest sie weiter im Programmheft. Von der Legende des »Indianerhäuptlings« Hiawatha, der seine Frau Minnehaha winters an eine Krankheit verlor und dass Dvořák vorhatte, vielleicht eine Oper über den Stoff zu schreiben. –
Mit dem Publikum in europäischen Konzerthäusern verhält es sich bis auf den heutigen Tag ein wenig wie mit Christoph Kolumbus. Es fährt aus, um mittels der vermeintlich »universalen Sprache« der klassischen, das ist, der nordwesteuropäischen, zwischen 1700 und 1950 geschriebenen Musik für traditionelle nordwesteuropäische Instrumente, die Welt zu umarmen. Und es kommt dabei doch allenfalls bis nach Amerika, wo ihm »Indianer« begegnen, denen europäische Erfolgskomponisten in gönnerhafter Manier »eine Stimme geben«. In einem auf Hochtouren laufenden Konzertbetrieb a.c. (ante covidi), in dem Orchestermanagerinnen, Veranstalter und Agenten sich bei der Gestaltung von Programmen über kaum mehr als die Frage verständigen mussten, in welcher Konfiguration ein populäres Solokonzert und ein »Meisterwerk der Sinfonik« diesmal präsentiert werde – der Dirigent hat auch leider keine Zeit, zu Proben für neues Repertoire früher anzureisen, da er tags zuvor dieselben Stücke noch auf der entgegengesetzten Seite des Erdballs mit seinem neuen Orchester aufführen müsse – war nicht nur die kuratorische und musikalische Praxis, sondern auch der Vermittlungsdiskurs für allzu lange Zeit von einer Naivität geprägt, die heute nur noch schwer entschuldbar ist. Erklärlich ist sie schon: Wo mit den Formulierungen der Konzertführer nicht nur die Informationen, sondern auch die Deutungsmuster einer zurückliegenden Zeit abgeschrieben werden, reproduziert sich im Konzertbetrieb die Mär von der universellen klassischen Musik in dem Maße exponentiell, wie sie sich auf ihre Provinz beschränkt. Amalgamierungen »fremder« Einflüsse können nur unterstützend wirken, diese Chimäre weiter zu nähren – dabei hat die Reise nach Amerika die Musik von Antonín Dvořák tatsächlich verändert. Und zwar weniger an den Stellen, an denen er sich möglicherweise vom Langgedicht des amerikanischen Einwandererkinds Henry Wadsworth Longfellow hat inspirieren lassen. Von entscheidendem Einfluss waren die Begegnungen mit dem afroamerikanischen Komponisten Henry Thacker (»Harry«) Burleigh, dessen Großeltern sich noch selbst als Sklaven frei kaufen mussten. Das Konservatorium besuchte Burleigh mit einem Stipendium, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen schlug er sich mit Handlangertätigkeiten durch. Dazu zählte auch, dass er im Konservatorium, an dem er studierte, als Reinigungskraft arbeitete. Bei der Arbeit sang er Spirituals, was dem neuen Direktor Dvořák sehr gefiel: »In the negro melodies of America I discover all that is needed for a great and noble school of music.« Was Dvořák sich von dieser Musik abschaute, lässt sich weniger leicht als Bild im Programmheft abdrucken als das oben beschriebene Porträt. Und vielleicht kann man es noch besser als in Dvořáks Sinfonie »Aus der neuen Welt« an zwei Kammermusikwerken festmachen. Der Musikwissenschaftler Hartmut Schick unterstreicht, dass sowohl Dvořáks 12. Quartett als auch das in unmittelbarer zeitlicher Nähe entstandene Quintett in offenem Gegensatz zur Tradition des Genres stehen und sich »entschieden anti-europäisch, was in diesem Fall vor allem bedeutet anti-deutsch« verhalten. Woran macht Schick dies fest? Zunächst bricht Dvořáks Quartett aus der Tradition aus, indem es nicht den von Beethoven in seinen letzten Quartetten vorgezeichneten Weg weiter geht, sondern das Streichquartett gewissermaßen aus dem Konzertsaal heraus, in sein ursprüngliches Terrain der »Hausmusik« zurückbefördert. »Schon hinsichtlich der Instrumentaltechnik gehört das Streichquartett sozusagen eher an die Ränder der Zivilisation, wo Spillville war, nicht nach Prag, Berlin oder London. Von seinen Inhalten ist es gar eher Freiluft- als Konzertsaalmusik«, so Hartmut Schick.
Der erste Satz breitet sofort eine schillernde Landschaft aus. Wie hier und an anderen Stellen programmatische Aspekte hineinspielen, ist in der Kammermusik neu und revolutionär: Vogelstimmen, Erinnerungen an das Orgelspiel, Naturerfahrung, Begegnungen. Nicht logisch auseinander heraus entwickelt, sondern unverbunden miteinander verbunden wie bei einem Gang durchs Dorf. Durchführung oder gar »entwickelnde Variation« werden reduziert zugunsten einer zyklischen, »ziellosen« Musik, in der das Gleiche auch noch einmal unverändert wiederkehren kann (und nur dadurch anders wird.)
Dies wird auch an den rhythmischen Ostinati deutlich, wie sie beispielsweise die Bratsche im Lento-Abschnitt wiederholt. Hier findet kein »Gespräch vernünftiger Leute« statt – stattdessen: »Wiederholung und Addition melodischer und rhythmischer Einheiten sowie additive Strukturen die entweder statisch sind oder sich im Kreis bewegen«, so Hartmut Schick. Dies wird vielleicht besonders am Beginn des vierten Satzes deutlich, wo zunächst ein »Groundbeat« gelegt wird, über dem sich die Melodien dann entfalten können. Typisch für Dvořák ist wiederum auch, dass er nie – so auch nicht in diesem Quartett – originale Vorbilder zitiert, sondern stets einen eigenen Weg findet. Viel wichtiger als die problematische Frage nach der Authentizität solcher Allusionen erscheint jedoch, dass Dvořák in Amerika Kammermusik geschrieben hat, die schließlich aus der europäischen Tradition ausbricht, »noch weiter als es die Streichquartette Arnold Schönbergs tun.« So schreibt Hartmut Schick weiter: »Es ist Musik, die sich oft genug auf nur vier oder fünf Töne beschränkt, anstatt sich der gesamten chromatischen Skala zu bedienen, Musik, die den Rhythmus als autonomes Element wiederentdeckt, das in der Spätromantik schon beinahe verloren war, eine Musik, die die einstimmige Melodie als eigenes Phänomen neu entdeckt und nicht in Wagner-Manier als Produkt der Harmonie ausgibt.« Übrigens lag auch der große Erfolg von Henry T. Burleigh vor allem in seinen »einstimmigen« Erfindungen: Als Komponist von Kunstliedern war er zu Beginn des 20. Jahrhunderts äußerst populär und hat hier ein enormes Korpus hinterlassen, das wieder zu entdecken wäre. Ein wichtiger Teil seiner Arbeit war auch die Transkription traditioneller Songs und Spirituals, ihre Übersetzung in die Notation der nordwesteuropäischen Klassik. Und eine solche Transkription möge an dieser Stelle den Abschluss des ersten Teils bilden. Nächstes Mal reisen wir weiter. Dann hoffentlich wirklich bis nach Indien. ¶
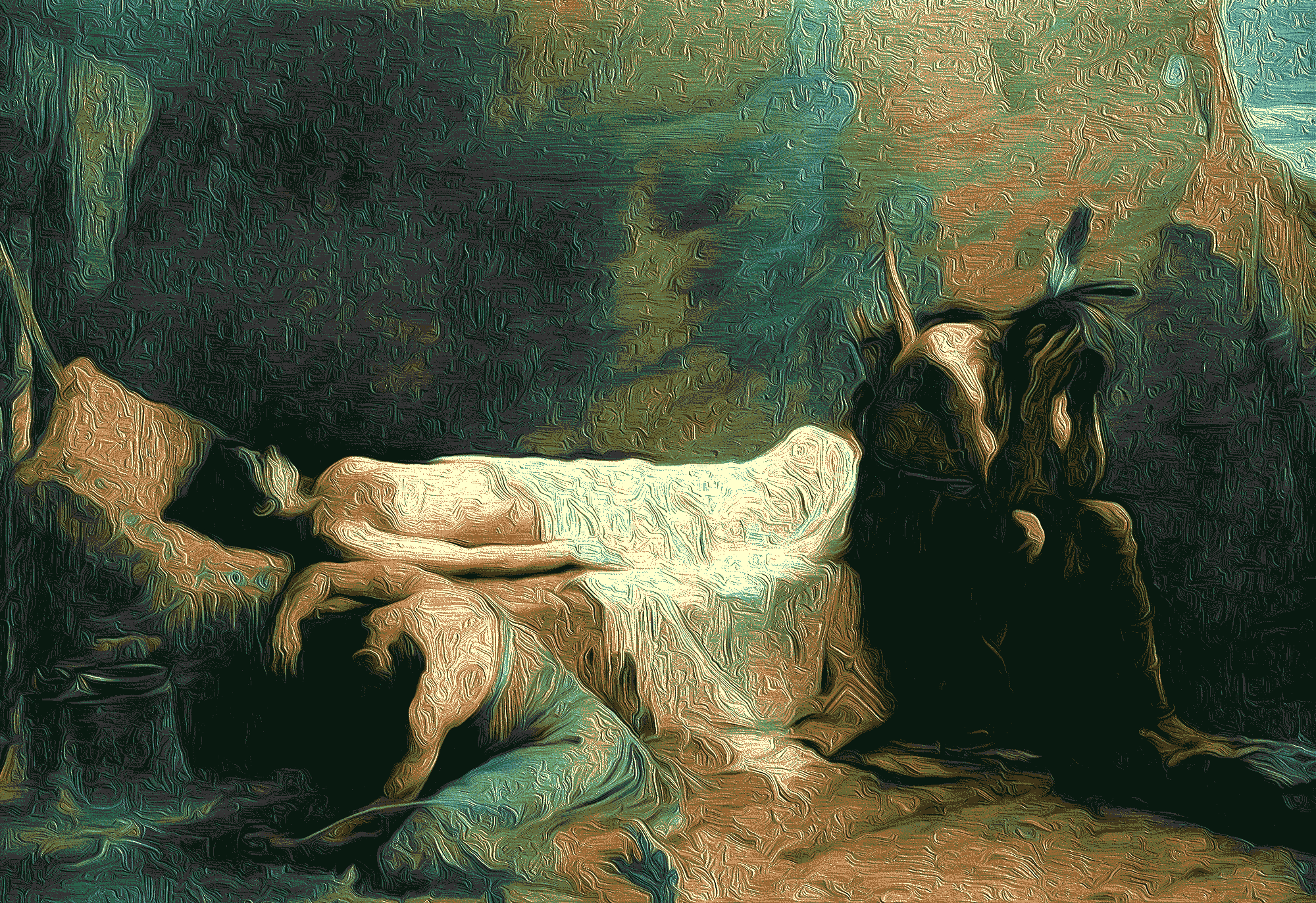
Text Patrick Hahn
Titelbild William de Leftwich Dodge (Public Domain)
Als der Blechbläserchoral das Largo aus Antonín Dvořáks Neunter Sinfonie eröffnet, bleibt der Blick der Programmheftleserin im Konzert an einem Bild haften: langes, pechschwarzes Haar wird von einem prächtigen Kranz von Adlerfedern gekrönt, sie bilden einen Rahmen für das glatte, bartlose, scharf geschnittene Gesicht aus dem heraus zwei dunkle Augen die Programmheftleserin unverwandt anblicken, der muskulöse Oberkörper ist nackt. Die Leserin überlegt, ob sie jemals zuvor in ihrem Programmheft einen Mann mit nacktem Oberkörper gesehen hat, sieht man von Haydn, Beethoven, Mozart doch ohnehin meist eines jener drei Gemälde, die es von ihnen gibt und von Brahms stets die Fotos im Sonntagsstaat. Auf dem Streicherteppich setzt nun das Englischhorn mit einem melancholischen Solo ein. Das Thema ist schön. Es berührt die Hörerin. Und während sich die Härchen an ihrem Unterarm für einen kurzen Augenblick aufrichten, liest sie weiter im Programmheft. Von der Legende des »Indianerhäuptlings« Hiawatha, der seine Frau Minnehaha winters an eine Krankheit verlor und dass Dvořák vorhatte, vielleicht eine Oper über den Stoff zu schreiben. –
Mit dem Publikum in europäischen Konzerthäusern verhält es sich bis auf den heutigen Tag ein wenig wie mit Christoph Kolumbus. Es fährt aus, um mittels der vermeintlich »universalen Sprache« der klassischen, das ist, der nordwesteuropäischen, zwischen 1700 und 1950 geschriebenen Musik für traditionelle nordwesteuropäische Instrumente, die Welt zu umarmen. Und es kommt dabei doch allenfalls bis nach Amerika, wo ihm »Indianer« begegnen, denen europäische Erfolgskomponisten in gönnerhafter Manier »eine Stimme geben«. In einem auf Hochtouren laufenden Konzertbetrieb a.c. (ante covidi), in dem Orchestermanagerinnen, Veranstalter und Agenten sich bei der Gestaltung von Programmen über kaum mehr als die Frage verständigen mussten, in welcher Konfiguration ein populäres Solokonzert und ein »Meisterwerk der Sinfonik« diesmal präsentiert werde – der Dirigent hat auch leider keine Zeit, zu Proben für neues Repertoire früher anzureisen, da er tags zuvor dieselben Stücke noch auf der entgegengesetzten Seite des Erdballs mit seinem neuen Orchester aufführen müsse – war nicht nur die kuratorische und musikalische Praxis, sondern auch der Vermittlungsdiskurs für allzu lange Zeit von einer Naivität geprägt, die heute nur noch schwer entschuldbar ist. Erklärlich ist sie schon: Wo mit den Formulierungen der Konzertführer nicht nur die Informationen, sondern auch die Deutungsmuster einer zurückliegenden Zeit abgeschrieben werden, reproduziert sich im Konzertbetrieb die Mär von der universellen klassischen Musik in dem Maße exponentiell, wie sie sich auf ihre Provinz beschränkt. Amalgamierungen »fremder« Einflüsse können nur unterstützend wirken, diese Chimäre weiter zu nähren – dabei hat die Reise nach Amerika die Musik von Antonín Dvořák tatsächlich verändert. Und zwar weniger an den Stellen, an denen er sich möglicherweise vom Langgedicht des amerikanischen Einwandererkinds Henry Wadsworth Longfellow hat inspirieren lassen. Von entscheidendem Einfluss waren die Begegnungen mit dem afroamerikanischen Komponisten Henry Thacker (»Harry«) Burleigh, dessen Großeltern sich noch selbst als Sklaven frei kaufen mussten. Das Konservatorium besuchte Burleigh mit einem Stipendium, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen schlug er sich mit Handlangertätigkeiten durch. Dazu zählte auch, dass er im Konservatorium, an dem er studierte, als Reinigungskraft arbeitete. Bei der Arbeit sang er Spirituals, was dem neuen Direktor Dvořák sehr gefiel: »In the negro melodies of America I discover all that is needed for a great and noble school of music.« Was Dvořák sich von dieser Musik abschaute, lässt sich weniger leicht als Bild im Programmheft abdrucken als das oben beschriebene Porträt. Und vielleicht kann man es noch besser als in Dvořáks Sinfonie »Aus der neuen Welt« an zwei Kammermusikwerken festmachen. Der Musikwissenschaftler Hartmut Schick unterstreicht, dass sowohl Dvořáks 12. Quartett als auch das in unmittelbarer zeitlicher Nähe entstandene Quintett in offenem Gegensatz zur Tradition des Genres stehen und sich »entschieden anti-europäisch, was in diesem Fall vor allem bedeutet anti-deutsch« verhalten. Woran macht Schick dies fest? Zunächst bricht Dvořáks Quartett aus der Tradition aus, indem es nicht den von Beethoven in seinen letzten Quartetten vorgezeichneten Weg weiter geht, sondern das Streichquartett gewissermaßen aus dem Konzertsaal heraus, in sein ursprüngliches Terrain der »Hausmusik« zurückbefördert. »Schon hinsichtlich der Instrumentaltechnik gehört das Streichquartett sozusagen eher an die Ränder der Zivilisation, wo Spillville war, nicht nach Prag, Berlin oder London. Von seinen Inhalten ist es gar eher Freiluft- als Konzertsaalmusik«, so Hartmut Schick.
Der erste Satz breitet sofort eine schillernde Landschaft aus. Wie hier und an anderen Stellen programmatische Aspekte hineinspielen, ist in der Kammermusik neu und revolutionär: Vogelstimmen, Erinnerungen an das Orgelspiel, Naturerfahrung, Begegnungen. Nicht logisch auseinander heraus entwickelt, sondern unverbunden miteinander verbunden wie bei einem Gang durchs Dorf. Durchführung oder gar »entwickelnde Variation« werden reduziert zugunsten einer zyklischen, »ziellosen« Musik, in der das Gleiche auch noch einmal unverändert wiederkehren kann (und nur dadurch anders wird.)
Dies wird auch an den rhythmischen Ostinati deutlich, wie sie beispielsweise die Bratsche im Lento-Abschnitt wiederholt. Hier findet kein »Gespräch vernünftiger Leute« statt – stattdessen: »Wiederholung und Addition melodischer und rhythmischer Einheiten sowie additive Strukturen die entweder statisch sind oder sich im Kreis bewegen«, so Hartmut Schick. Dies wird vielleicht besonders am Beginn des vierten Satzes deutlich, wo zunächst ein »Groundbeat« gelegt wird, über dem sich die Melodien dann entfalten können. Typisch für Dvořák ist wiederum auch, dass er nie – so auch nicht in diesem Quartett – originale Vorbilder zitiert, sondern stets einen eigenen Weg findet. Viel wichtiger als die problematische Frage nach der Authentizität solcher Allusionen erscheint jedoch, dass Dvořák in Amerika Kammermusik geschrieben hat, die schließlich aus der europäischen Tradition ausbricht, »noch weiter als es die Streichquartette Arnold Schönbergs tun.« So schreibt Hartmut Schick weiter: »Es ist Musik, die sich oft genug auf nur vier oder fünf Töne beschränkt, anstatt sich der gesamten chromatischen Skala zu bedienen, Musik, die den Rhythmus als autonomes Element wiederentdeckt, das in der Spätromantik schon beinahe verloren war, eine Musik, die die einstimmige Melodie als eigenes Phänomen neu entdeckt und nicht in Wagner-Manier als Produkt der Harmonie ausgibt.« Übrigens lag auch der große Erfolg von Henry T. Burleigh vor allem in seinen »einstimmigen« Erfindungen: Als Komponist von Kunstliedern war er zu Beginn des 20. Jahrhunderts äußerst populär und hat hier ein enormes Korpus hinterlassen, das wieder zu entdecken wäre. Ein wichtiger Teil seiner Arbeit war auch die Transkription traditioneller Songs und Spirituals, ihre Übersetzung in die Notation der nordwesteuropäischen Klassik. Und eine solche Transkription möge an dieser Stelle den Abschluss des ersten Teils bilden. Nächstes Mal reisen wir weiter. Dann hoffentlich wirklich bis nach Indien. ¶
Wir nutzen die von dir eingegebene E-Mail-Adresse, um dir in regelmäßigen Abständen unseren Newsletter senden zu können. Falls du es dir mal anders überlegst und keine Newsletter mehr von uns bekommen möchtest, findest du in jeder Mail in der Fußzeile einen Unsubscribe-Button. Damit kannst du deine E-Mail-Adresse aus unserem Verteiler löschen. Weitere Infos zum Thema Datenschutz findest du in unserer Datenschutzerklärung.
OUTERNATIONAL wird kuratiert von Elisa Erkelenz und ist ein Kooperationsprojekt von PODIUM Esslingen und VAN Magazin im Rahmen des Fellowship-Programms #bebeethoven anlässlich des Beethoven-Jubiläums 2020 – maßgeblich gefördert von der Kulturstiftung des Bundes sowie dem Land Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg Stiftung und der L-Bank.
Wir nutzen die von dir eingegebene E-Mail-Adresse, um dir in regelmäßigen Abständen unseren Newsletter senden zu können. Falls du es dir mal anders überlegst und keine Newsletter mehr von uns bekommen möchtest, findest du in jeder Mail in der Fußzeile einen Unsubscribe-Button. Damit kannst du deine E-Mail-Adresse aus unserem Verteiler löschen. Weitere Infos zum Thema Datenschutz findest du in unserer Datenschutzerklärung.
OUTERNATIONAL wird kuratiert von Elisa Erkelenz und ist ein Kooperationsprojekt von PODIUM Esslingen und VAN Magazin im Rahmen des Fellowship-Programms #bebeethoven anlässlich des Beethoven-Jubiläums 2020 – maßgeblich gefördert von der Kulturstiftung des Bundes sowie dem Land Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg Stiftung und der L-Bank.